40 Stunden Labour und unendliche Freude
Die Engländer haben schon lustige Formulierungen: Wenn frau in den Wehen liegt, sagen sie dazu to be in labour. Und labour, das bedeutet zu Deutsch soviel wie Arbeit, Mühe. In meinem Fall umfasste das in-labour-sein, einer Wehenschwäche sei Dank, das wöchentliche Arbeitspensum eines normal Vollbeschäftigten, also 40 Stunden.
Plisch-Platsch
Los ging es mit einem Blasensprung. Plisch-Platsch, Bett war nass. Ans Einschlafen war nicht mehr wirklich zu denken. Umso brennender die Frage: Wann geht’s los? Die Wehen ließen eine ganze Nacht und einen ganzen Tag auf sich warten. Wie gut, dass der Tag, ein Sonntagmorgen Mitte September, sich spätsommer-
lich zeigte. Meine Freundin und Hebamme Lena gab mir Sanktus und Segen zu einem wehenanregenden Glas Rotwein. Hurra, endlich mal wieder! Ein schwaches Achterl in Ehren und einen Spaziergang in den Weinbergen später starteten die Wehen – wieder mal auf dem Weg ins Bett. Schlaf ist sowieso ein rares Gut nach der Geburt, warum also nicht darauf einstimmen?
Die Wehen steigerten sich rasch von zehn auf fünf Minuten- Abstände. Also rückten meine beiden Hebammen Lena und ihre Praktikantin Karin rasch herbei. Für die Hausgeburt war alles vorbereitet: von essentiellen Dingen wie Gebärpool, Tücher und vielen Kissen bis hin zum nicht gerade notwendigen Zetterl Kreißsaal an der Wohnzimmertüre.
Wofür man nicht alles Zeit hat, wenn man auf die Wehen wartet. Ich war bereit, die Wehen waren regelmäßig und intensiv, aber mein Muttermund wollte nicht recht aufgehen. Also ein bisschen wie der motivierte Arbeiter im Montagmorgenstau auf der Tangente: Da mag er noch so eifrig in die Hände spucken, er kann das Sozialprodukt nicht steigern, wenn ihn die Blechlawine nicht lässt.
Streik!
Als ich kurz vor einem ersten Höhepunkt der Wehen gegen drei Uhr Früh in den Gebärpool stieg, in der Erwartung, dass es dort so richtig abgehen würde, passierte plötzlich NICHTS MEHR. Niente. Wie bei einem Streik der Eisenbahner in Italien. Mein Bauchbewohner schien sich zu denken: „Super, endlich ist dieses laute ‚Jaaaaaaaaaaa!‘ (Anmerkung: ich tönte bei jeder Wehe) viel leiser. Und warum raus in die kalte Welt, wenn es sich hier so schön herumfloaten lässt?“
Als mein Freund mit dem Wasserkocher heißes Wasser nachfüllte, scherzte ich: „Fehlt nur noch der Kochlöffel und fertig ist das Kannibalenfeeling.“ Ungekocht, aber leicht verschrumpelt stieg ich eine Weile später aus meiner flüssigen Bleibe. Hinlegen und schlafen? Gute Idee, nur leider ging es im Liegen wehentechnisch so richtig los. Also hieß es im Sitzen schlummern, ähnlich wie ein verkaterter Arbeitnehmer in seiner Mittagspause es wohl versuchen könnte. Der Morgen graute und mir graute, dass die nächste Untersuchung des Muttermunds keine guten Nachrichten bringen würde. Und so war es auch: Läppische drei Zentimeter war er offen und verkroch sich weit nach hinten. Na super. Feiges Trum. Bei babyblauem, wolkenlosem Himmel wollte bei mir auch nicht so recht Gebärstimmung aufkommen, allen wehenanregenden Massagen, antroposophischen Pulvergaben und motivierten Worten zum Trotz. Und so ging Montag tagsüber nicht wirklich etwas weiter.
Da ich mit dem Druck auf dem Damm nicht so gut klar kam, winselte ich um einen Einlauf. Immer wieder verkroch ich mich aufs teelichtbeleuchtete Klo. Als mir dort von einigen Wehen sehr übel wurde und es mir oben raus kam, frohlocke mein Geburtsteam: JETZT würde es losgehen. Denn ich war mittlerweile am Verzweifeln, mitten in der Ich will und ich kann nicht mehr, soll doch wer anderer dieses Kind bekommen, ich hab genug-Phase.
Ein gutes Zeichen für die Hebammen: An diesen Punkt kommt jede Frau. Und ab dann kommt die Sache meist so richtig ins Laufen. Nicht bei mir.
Bitte ein Kaiserschnitt!
Die Stunden vergingen weiter im Wehenanregungsprogramm.
In einem Geburtsvorbereitungskurs hörte ich den Vergleich, dass eine Geburt wie eine lange Bergtour sei. Man startet auf einem flachen Weg im Tal und muss mit seinen Kräften bis zum steilen Gipfelanstieg auskommen. Jeder vernünftige Bergsteiger setzt sich ein Limit. Meines schien mir erreicht. Um Mitternacht herum meinte ich: „Bis zwei Uhr und nicht länger. Dann will ich ins Krankenhaus. Und dort sollen sie mir meinetwegen das Kind per Kaiserschnitt holen.“ (Anmerkung: Und das aus dem Mund einer Kaiserschnitt ist nur eine Notlösung-Überzeugten). Meine Knie zitterten, das Becken loszulassen war jedes Mal ein Kraftakt sondergleichen – und immer noch kein Gipfelkreuz in Sicht. Nach einem nervlichen Totalzusammenbruch schafften es Lena, Karin und mein Freund Franz, mich noch einmal zu motivieren: „Komm Kathi, vier Wehen noch und dann fahren wir.“ Der Streber in mir machte Überstunden: Ich gab mir sechs positiv gestimmte Wehen, ohne Verzweiflung sondern mit ganz viel Willen. Als auch diese nichts voran brachten, packten wir um 4 Uhr Früh enttäuscht, aber entschlossen, unsere sieben Sachen und fuhren ins Badener Spital. Irgendwie hatte ich die Erwartung: „Prima, dort kann ich alles abgeben.“ So als würde wer anderer dort mein Kind auf die Welt bringen. Aber eine Geburt lässt sich nicht delegieren wie die lästige Aufgabe im Büro. Die Gebärmutter hat keine Vorgesetzte, nur Mitarbeiter. Auf der Geburtsstation war nichts los – gut! Volle Konzentration auf mich, yipee! Die diensthabende Hebamme gab mir erst mal ein Schmerzmittel – endlich konnte ich ein wenig schlafen. Franz kuschelte sich an meinen Rücken, Lena durfte zum Glück bleiben. Karin war zu ihren Kids heimgefahren.
Flutsch — und da!
Nach dem Dienstwechsel um sieben Uhr Früh kam eine ausgeschlafene, junge und motivierte Hebamme namens Theresa zu mir. Die zwei Stunden Schlaf hatten Wunder gewirkt: Mein Wunsch nach einem Kaiserschnitt, gar nach einer PDA, war passé. Ich wollte es noch einmal versuchen. Ich kam an einen Wehentropf. Für viele Frauen ist der wohl eine Horrorerinnerung, für mich war
er eine Erlösung: Ich wusste, dass die Wehen nun regelmäßig kommen würden. Das entspannte mich so sehr, dass ich gar nicht mehr richtig die Augen aufmachte – ich verbrachte die nächsten Stunden in einer Art Dämmerzustand, nur unterbrochen von den Wehen. Und endlich: Mein Muttermund öffnete sich. Um 13 Uhr begann die Schiebephase. Es tat höllisch weh. Aber ich wusste: Jetzt passierts! Das Gefühl, meinen Sohn Franz Isidor nach all den Stunden endlich im Geburtskanal zu spüren, gab mir einen extremen Kick. Normalerweise fliege ich in Ohnmacht, wenn ich mich in den Finger schneide, nun freute ich mich über den Schmerz. Als ich den Kopf meines Kindes mit den Händen fühlen konnte, begannen alle um mich herum zu weinen. Ich wunderte mich: „Momeeent, was habt ihr alle, ich habs ja noch gar nicht geschafft!“ Aber Lena, Franz und meine dazu gekommene Mama waren einfach zu gerührt. Einen Positionswechsel und sieben Press-
wehen später war es soweit: 53 Zentimeter und 3590 Gramm Leben flutschten aus mir raus. Und ich flutschte in einen nie dagewesenen Glückszustand. Die Labour hat sich sowas von ausgezahlt! Aber aufs Wochenende warte ich immer noch.
Katharina Glatz.
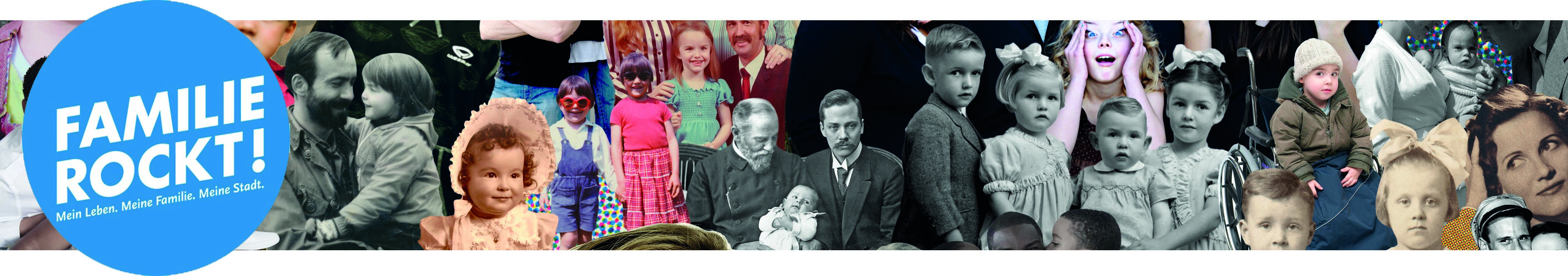




5 Kommentare
Judith Leitl liked this on Facebook.
Magdalena Mittler liked this on Facebook.
Sandra Teml-Jetter liked this on Facebook.
Elisa Köck liked this on Facebook.
Long Labour & Happy End! http://t.co/00C92qZLNJ